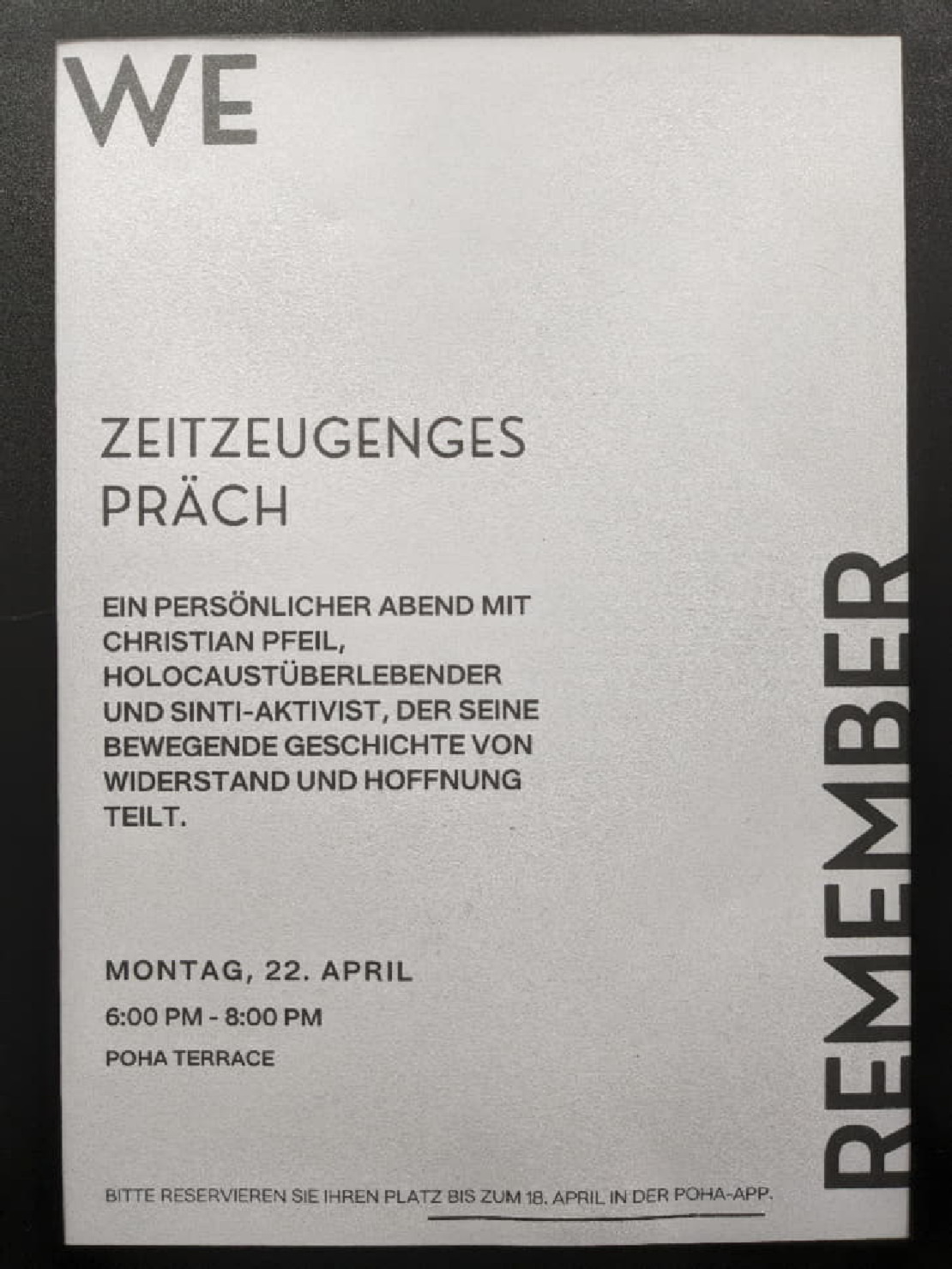Sonntagsausflüge zu Tante Müller waren der Inbegriff der Qual. Die Fahrten zu ihr fühlten sich an wie das Schlingern eines Piratenschiffs in stürmischer See. Nur, dass unser "Schiff" lediglich ein schwarzer Mercedes 200 war. Der Wagen, viel zu weich gefedert, hüpfte durch die engen Kurven des Teutoburger Waldes. Dazu mischte sich im Auto eine exquisite Duftkomposition aus Benzin, kaltem Zigarettenrauch und den chemischen Ausdünstungen der glatten Kunstledersitze.
Mit diesem Auto durch den Teutoburger Wald? Jedes Mal ein Höllentrip, der meinen Magen zuverlässig in Aufruhr versetzte.
Meine Rettung? Ein Stapel Brötchentüten, den mir meine Stiefmutter vor der Fahrt vorausschauend überreichte. Kotztechnisch bestens ausgestattet, um im Falle eines Falles keine halb verdauten Überbleibsel im Auto zu verstreuen.
Und dann erst die Sommerausflüge! Aus der kurzen Lederhose schauten meine nackten Oberschenkel heraus, die sich vollflächig mit dem Kunstleder der Sitze vereinten. Meine Stiefmutter musste mich regelmäßig aus dieser Verklebung retten, zerrte mich aus dem Auto, manchmal ein paar Hautfetzen meiner nackten Beine auf dem Sitz zurücklassend. Zumindest fühlte es sich so an.
Das Ankommen bei Tante Müller und ihr feuchtes Begrüßungsritual mitten auf meinen Mund waren der Auftakt zu einer surrealen Show. Mein Magen noch in Aufruhr, wurden wir direkt an den Tisch verfrachtet. Ich immer gegenüber von Oma Müller, als hätte ich den Hauptpreis für den ungünstigsten Platz gewonnen. Oma Müller, eingehüllt in ein düsteres schwarzes Kleid mit weißem Kragen, sprach nie ein Wort und starrte konzentriert geradeaus. Ihre Blickrichtung? Irgendwo hinter mir, als gäbe es dort eine unsichtbare Kinoleinwand.
Und dann die Showeinlage: Oma Müller kippte regelmäßig mit ihrer rechten Körperseite auf das schwarze Sofa. Meistens ließ man sie so liegen, als wäre sie Teil einer modernen Kunstinstallation. Das Aufrichten zu Beginn der Mahlzeiten war eine Zirkusnummer, die Tante Müller und Stiefmutter beherrschten wie zwei Clowns im Zirkus. Eine zog, die andere drückte. Und Oma Müller stöhnte im Takt dazu.
Das Essen: Rouladen, Jägerschnitzel, Knödel, Spargel, Rotkohl, Königsgemüse – ein Essensangebot, das mein Magen und ich schon aus ethischen Gründen ablehnten.
Der krönende Abschluss: Götterspeise, die wie ein Flummi vom Teller sprang und nur mit einer Flut von Vanillesauce genießbar war.
Das Sahnehäubchen? Oma Müller, vollgesabbert, mit halb verdautem Essen dekoriert, direkt in meinem Blickfeld.
Nach dem Essen begann das große Reinemachen. Oma Müller wurde von Essensresten befreit, die man großzügig mit ihrer bekleckerten Stoffserviette auf ihrem Kleid verteilte. Stiefmutter und Tante Müller verschwanden mit dem schmutzigen Geschirr in der Küche, wahrscheinlich um dort über die Rettung der Welt zu debattieren, ohne mich daran teilhaben zu wollen.
Meine Aufgabe? Auf Oma Müller aufzupassen. Eigentlich nicht viel zu tun außer zu warten, bis sie wieder wie ein betrunkenes Dackelchen auf die rechte Seite kippte. Mit einem erleichterten Seufzen, das klang, als wären gerade mehrere Säcke Kartoffeln von ihren Schultern genommen worden. Dann starrte sie, diesmal um 90 Grad gekippt, unter dem Tisch her – dort gab es eigentlich auch nichts zu sehen außer meinen endlos langen Beinen, die aus meiner Lederhose ragten.
An einem dieser skurrilen Sonntage, ausgefüllt mit Kotzerei, sabbernder Stille von Oma Müller, widerlichem Sonntagsbraten und den endlos lange murmelnden Frauen in der Küche, kam mir ein Geistesblitz. Erinnerungen an eine Physikstunde mit Lehrer Mümmelmann (ja, wirklich sein Spitzname!) kehrten zurück, der uns mal das Hebelgesetz erklärte. Die alten Ägypter bauten Pyramiden mit diesem physikalischen Prinzip – aber hier? Zwei Frauen, die sich jedes Mal abrackerten, um die umgefallene Oma Müller wieder aufzurichten? Das ging bestimmt auch anders.
Also stellte ich mich in der Mitte des Körpers von Oma Müller auf das Sofa und zog ihren Arm schräg zu mir hoch. Mit mehr Kraftaufwand als erwartet und einem unüberhörbaren Knacken in ihrer Schulter schaffte ich es, diese menschliche Masse aufzurichten. Sie seufzte. Ich schenkte ihr ein zufriedenes Grinsen, hoffend, dass das Knacken in der Schulter nicht der Bruch eines wichtigen Knochens gewesen war.
Toll, diese Sache mit dem Hebelgesetz.
Zurück am Tisch, gegenüber von Oma Müller ein vollkommen neues Bild: Oma Müller starrte nicht die Wand hinter mir an, sondern direkt in mein Gesicht. Sagte aber trotzdem nichts. Und sie blieb länger als die üblichen 10 Minuten aufrecht sitzen, als hätte ich ihr ein Wundermittel verabreicht.
Tante Müller und Stiefmutter traten nach gefühlten zwei Stunden zurück ins Wohnzimmer – verwundert darüber, dass Oma Müller nicht wie üblich auf dem Sofa lag.
"Warum sitzt Oma und liegt nicht auf dem Sofa?", fragte Tante Müller irritiert.
"Ich habe das Hebelgesetz angewendet.", antwortete ich stolz, verschwieg aber das Knacken der Knochen.
Stiefmutter spottete: "Ach ja, der Herr Professor zeigt uns mal wieder seine Gymnasialkünste. Hat tatsächlich mal was fürs Leben gelernt!"
Ja, so war sie eben. Hätte mich lieber auf der Realschule gesehen. Mit einer anschließenden handwerklichen Ausbildung als Rüstzeug für das Leben. Schade auch.
Epilog:
Beim Aufschreiben dieses Textes ca. 50 Jahre nach den beschriebenen Ereignissen stellt sich mir die Frage, ob es nicht sein kann, dass die Oma aus reiner Schutzhaltung immer auf ihre rechte Körperseite und nie auf die linke Seite gefallen ist und ob ich durch das Zerren an ihrem linken Arm in ihrem knackenden Schultergelenk irgendwas ausgelöst habe, dass sie endlich längere Zeit sitzen konnte. Es wäre wichtig für mich zu wissen, ob ich ihr nicht Schmerzen oder gebrochene Knochen hinterlassen habe. Dass ich endlich diese Gewissensbisse überwinde. Ich bin kein Mediziner, sondern nur ehemaliger Informatiker und frage daher die Künstliche Intelligenz:
Frage an ChatGPT:
„Kann es sein, dass man nach einem Ziehen am Arm und Knacken im Schultergelenk eine Erleichterung spürt?“
Antwort von ChatGPT:
„Ja, es kann tatsächlich sein, dass nach einem Ziehen am Arm Schmerzen und Knacken im Schultergelenk nachlassen und man eine Erleichterung spürt. Es gibt mehrere mögliche Gründe dafür:
- **Einrenken von Gelenken**: Manchmal kann ein leicht aus dem Gelenk gerutschtes Schultergelenk oder ein kleiner Gelenkblock durch das Ziehen am Arm wieder in die richtige Position gebracht werden. Das Einrenken kann sofortige Erleichterung und Reduktion des Knackens bewirken.
- **Lösen von Verklebungen und Verspannungen**: Das Ziehen am Arm kann helfen, Verklebungen oder Verspannungen in den Muskeln, Sehnen und Bändern rund um das Schultergelenk zu lösen. Dies kann die Beweglichkeit verbessern und Schmerzen sowie Knacken reduzieren.
- **Nervenentlastung**: Wenn ein Nerv eingeklemmt oder gereizt war, kann das Ziehen am Arm den Nerv entlasten, was zu einer sofortigen Linderung der Schmerzen führen kann.
- **Durchblutungsverbesserung**: Das Ziehen kann die Durchblutung im Schulterbereich fördern, was die Versorgung der betroffenen Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen verbessert und die Schmerzwahrnehmung verringern kann.
- **Muskelentspannung**: Ein kontrolliertes Ziehen am Arm kann die Muskulatur um die Schulter entspannen, was wiederum Schmerzen und Knacken reduzieren kann.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass solche Manipulationen auch Risiken bergen können, insbesondere wenn sie unsachgemäß durchgeführt werden. Wiederholtes oder unsachgemäßes Ziehen am Arm kann zu Verletzungen führen oder bestehende Probleme verschlimmern. Wenn du wiederkehrende oder anhaltende Probleme mit der Schulter hast, ist es ratsam, einen Arzt oder Physiotherapeuten aufzusuchen, um eine genaue Diagnose und geeignete Behandlung zu erhalten.“
Meine Erkenntnis:
Ich lass das mal so stehen. Anscheinend habe ich nicht nur gehebelt, sondern dadurch auch noch Schmerzen gelindert ...